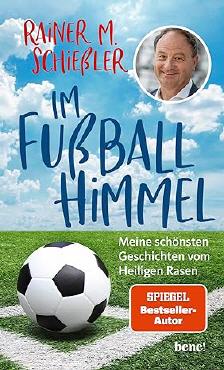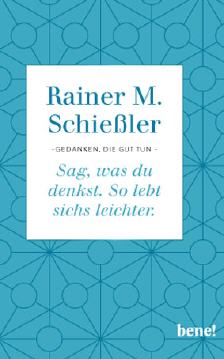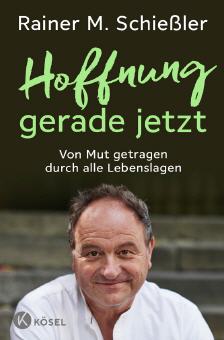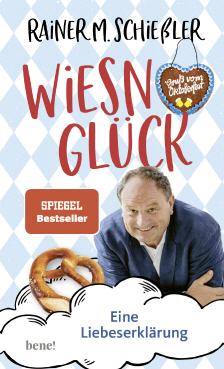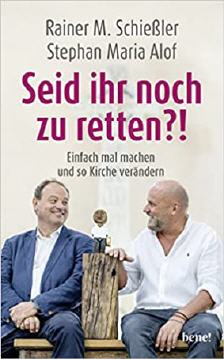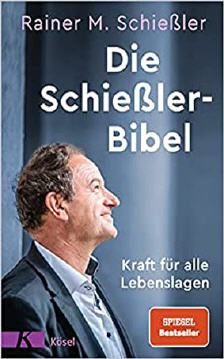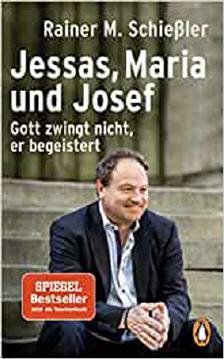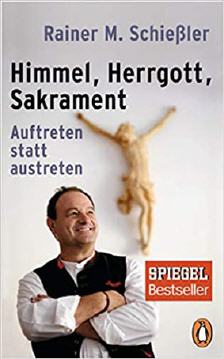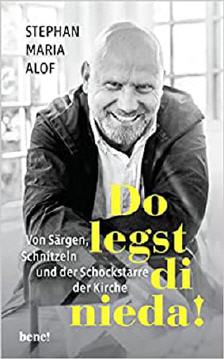21.07.2024
Es gibt ein archetypisches Bild, das die beiden biblischen Lesungen des heutigen Sonntags miteinander verbindet. Das ist das Bild vom Hirten und seiner Herde. In der Lesung aus dem Buch des Propheten Jeremia ruft Gott den schlechten Hirten, die die Schafe seiner Herde zugrunde richten und zerstreuen, sein „Wehe“ entgegen. Die schlechten Hirten, das sind die Könige Israels zur Zeit des Jeremia, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen und sich nicht um ihre Schafe kümmern. Gott verheißt seinem Volk, dass er sich selbst um Israel kümmern wird. Gott will neue, gute Hirten bestellen. Ja, es wird der Tag kommen, an dem aus dem Geschlecht Davids jemand berufen werden soll, der als König und Hirt Israel endgültig retten soll.
Die neutestamentliche Überlieferung sieht in Jesus diesen neuen und guten Hirten Israels. Darum lesen wir im MkEv: [Jesus] hatte ... Mitleid mit [den Menschen]; denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.
Für die Bibel, ja für den ganzen altorientalischen Kulturkreis war der Hirt und seine Herde etwas Alltägliches. Auf Schritt und Tritt konnte man Hirten und ihren Herden begegnen. Hirt sein war ein durchaus geachteter und verantwortungsvoller Beruf. Man musste sich auf den Hirten verlassen können, denn wenn man ihm eine Herde überantwortete, dann war das ein nicht unbeträchtliches Vermögen. Der Hirt musste die Tiere zusammenhalten und im Notfall gegen Räuber und wilde Tiere verteidigen.
Heute sieht es da anders aus. Hirten, die mit ihren Herden über das Land ziehen, sind eine Seltenheit geworden. Und auch die symbolische Bedeutung des Wortes „Hirt“ macht uns eher Schwierigkeiten. Wo ein Hirt oder sogar ein Oberhirt ist, da gibt es auch Schafe. Wer aber möchte schon gerne ein dummes Schaf sein? Die Herde gilt uns eher als Inbegriff einer beliebig manipulierbaren und steuerbaren Menge. Nicht umsonst spricht man etwas abfällig vom Herdentrieb. Unsere Bischöfe tragen zwar bei offiziellen Anlässen ihren traditionellen Hirtenstab. Aber es würde wohl keiner wagen, eine versammelte Gemeinde zu begrüßen mit den Worten: „Guten Tag, liebe Schafe, ich bin euer Hirt und wollte mal nach dem Rechten sehen“. Im Zeitalter des „Synodalen Wegs“ schon gar nicht.
Menschen von heute, auch Gläubige von heute wehren sich: Wir sind keine Schafe, wir sind aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts! Und wir brauchen auch keinen Hirten, wir haben ja unsere demokratischen Institutionen. Wir haben keinen nötig, der uns an die Hand nimmt und versorgt und führt. Wir sind autonom.
Da ist sicher was dran. Dennoch: können wir auf Hirten oder auch Hirtinnen so ganz verzichten? Brauchen wir nicht Sympathieträger, Symbolfiguren, Wegweiser?
Programme, Theorien, Ideen, Visionen, Institutionen – sie brauchen ein Gesicht. Ein menschliches Antlitz, damit sie wirken und motivieren. Inspiratoren, Vermittler, Brückenbauer – biblisch gesprochen: Hirten.
Das Evangelium für sich allein genommen hätte schon damals nichts genutzt, wenn Jesus ihm nicht sein Gesicht gegeben hätte. Und dann auch seine Jüngerinnen und Jünger.
Demokratie lebt nicht bloß von Programmen, Parteien und Abstimmungen. Das ist zu abstrakt. In der Politik geht es vor allem um Personen. Ja, jetzt gibt es sogar eine Partei, die ausdrücklich nach einer Person benannt ist: Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Die Botschaft ist klar, der Name Programm. Da muss man das Programm schon gar nicht mehr lesen. Es geht eher um Vertrauen in eine Person. Das ist vielleicht ein bisschen viel Personenkult. Und doch: Die Demokratie ist nur dann wirklich lebendig, wenn die Personen in den höchsten Staatsämtern auch etwas vom Geist unserer Verfassung spüren lassen. Eine Demokratie ohne Persönlichkeiten ist auf Dauer und im Ganzen nicht lebensfähig.
Und auch eine Kirche ohne gute und qualifizierte Hirten verliert irgendwann ihre Richtung und ihre Anziehungskraft. Es braucht auch hier Persönlichkeiten. Wirkliche Autorität statt nur geliehene, formale Autorität. Glaubwürdigkeit. Bischöfe, die Menschen beeindrucken durch ihre Art, ihr Wort, ihr Wesen.
Solche Bischöfe scheinen aber weniger zu werden. Die katholischen Oberhirten in Deutschland haben es natürlich auch nicht leicht, gesellschaftlich wie innerkirchlich. Das Thema des sexuellen Missbrauchs überschattet immer noch die kirchliche Praxis. Und doch würde man sich wünschen, dass es jemand gibt, der aus diesem Schatten gleichsam heraustritt und das Ansehen der Kirche wieder entscheidend verbessern könnte.
Und wenn wir eine Ebene tiefer gehen, dann verlieren viele Gemeinden durch den zunehmenden Priestermangel ihre Hirtengestalten. Es geht eben nicht nur um Verwaltung, darum, dass dem Kirchenrecht Genüge getan wird. Es geht um Präsenz im Leben der Menschen, auch einfach durch Anwesenheit vor Ort. Es geht um Inspiration. Teams, Räte und Gremien allein reichen nicht – es muss jemand da sein, der durch seine Person das Evangelium symbolisiert und verdichtet. Jemand, der oder die Vertrauenswürdigkeit, Charisma, Menschlichkeit ausstrahlt.
Insofern erscheint es dringend angezeigt, dass die Zulassungsbedingungen zum priesterlichen Amt überdacht und verändert werden. Sonst gehen uns die „Hirten“ in bestimmten Teilen der Weltkirche gänzlich aus. Und warum sollte es nicht auch „Hirtinnen“ geben im kirchlichen Amt?
Denn das ist auch für uns aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts nicht gut: wie Schafe zu sein, die keine Hirten haben. Oder in heutiger Diktion/Sprache: Gläubige, die keine inspirierenden Identifikationsfiguren mehr haben.
Rüdiger Hagens